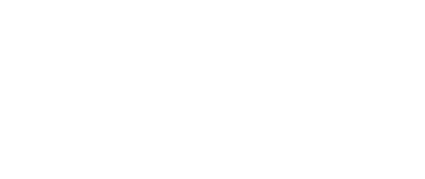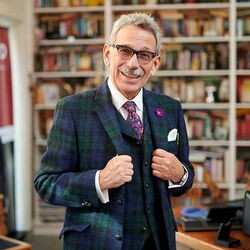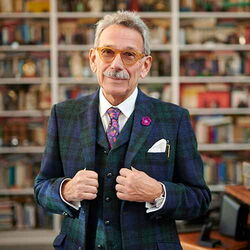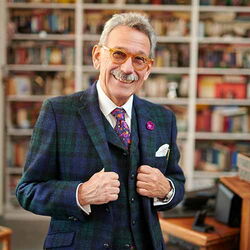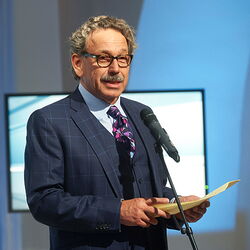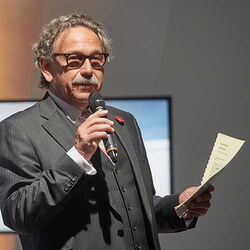Logbuch
Vom alten Regime der Hosenanzüge und IKEA als neuer Leitkultur
Was interessiert die Leute wirklich? Der Leitartikel in der FAZ? Die Verrenkungen des Focus, um als „bürgerliche“ Alternative zum Spiegel zu gelten? Die Leute interessieren sich für Leute. Gelästert wird in meiner Stammkneipe beispielsweise über das neue Outfit des „ruling gender“ der „upper classes“, den notorischen Hosenanzug der frisurfreien Frauen („Uniform der Ungepflegten“). Äußerlichkeiten, klar. Und ein Männerthema. Ja, die Zahl der schlecht angezogenen Männer ist deutlich höher. Ja, bei denen sagt keiner was. Aber die Leute interessiert eben, wie andere Leute leben, sprich lifestyle.
Was uns an „Bauer sucht Frau“ fasziniert, das ist dieses Thema „Lebensentwürfe“. Nur dort, wo Politik so lebensnah wird, sprich zu diesem Boulevard findet, bewegt sie noch was. Zur Wahl stehen für viele Wähler nicht Programme, Werte oder Charaktere, sondern Lebensstile. Die wichtigste Ablösung eines alten Lebensstils durch einen neuen, die wir in einem Menschenleben kennen, ist die des Generationswechsels. Wir verstehen intuitiv, wenn ein neuer Lebensentwurf einen anderen alt aussehen lässt. Die Lebenserfahrung des Generationswechsels nimmt dem Machtwechsel den Ludergeruch der Revolte oder Intrige.
Man freut sich auf die jungen Menschen, wenn man die alten leid ist. Ende der Eiszeit, Frühlings Erwachen. „Wohnst Du noch oder lebst Du schon“, das ist die Hymne der Moderne. Das ist es, was die Presse nach der leidvollen Erfahrung mit dem amtsmüden Ehepaar Köhler am „frischen“ Stil von Bundespräsident Wulff lobt. Jeder Wiederwahl der schon mal Abgewählten hängt der Beigeschmack alter Gewohnheiten an, aber nicht der Zauber einer neuen Liebe. Der Wähler meint, einen geschiedenen Partner, den er glücklich los geworden ist, noch mal nehmen zu sollen. Statt „honeymoon“ : the same procedure as every year.
Die Parteipolitik hat es nicht leicht. Denn alles hängt am Honeymoon, der einen Nacht, am Wahlausgang. Wahlen sind aber das große Mysterium einer Demokratie. Man weiß nach dem Urnengang, wen die Menschen gewählt haben, hat aber keine Ahnung, warum sie das getan haben. Die Sieger eines Wahlkampfes fühlen sich bestätigt. Die Verlierer schmieden Verschwörungstheorien und sinnen auf sanfte Rache am Souverän. Das Volk insgesamt guckt nicht selten verdutzt, was nun wieder als der Wille aller Wahlberechtigten herausgekommen ist. Die Opferbeschauer des demokratischen Betriebes, auch Demoskopen genannt, entwerfen wilde Theorien über Wanderbewegungen zwischen den Parteien, die zu Recht niemand versteht.
Man kann eine ganze Liste von Irrtümern abarbeiten, die politische Präferenzen zu erklären suchen. Nummer eins: Der Wähler entscheidet sich gemäß seiner sozialen Lage, sprich der Klassen- oder Schichtzugehörigkeit. Das war einmal. Und selbst unter den Bedingungen der geordneten Klassengesellschaft des 19. Jahrhunderts gab es schwierige Entscheidungssituationen. Sollte das Proletariat sich den Kommunisten zuwenden oder den Sozialdemokraten? War das Bürgertum im Zentrum gut aufgehoben oder bei den Deutschnationalen? Welche politische Konsequenz ziehen die Wähler aus einer Weltwirtschaftskrise und einem schmachvoll verlorenen Weltkrieg? Nun, die Weimarer Republik hat den Faschismus gewählt und gewollt, später irreführend als Machtergreifung Hitlers geklittert.
Hypothese Nummer drei: Weltanschauung ist es, die die Menschen treibt, wenn sie in der Wahlkabine ihr Kreuzchen machen. Auch hier ein Verfall der gegliederten Welt: Es gibt sie nicht mehr, die ideologischen Blöcke. Was ist an der CDU unter Merkel noch konservativ? Die Sozialdemokratie ringt darum, was heute noch „links“ sein mag, lässt sich dabei aber die ehedem eigenen Themen von der Union und den Grünen und der Linkspartei stehlen. Rückschlüsse ideologiekritischer Natur sind nicht mehr möglich. Es scheint zum Geheimrezept der politischen Selbstverzauberung geworden zu sein, die politischen Parolen des Gegners kokett auf die eigenen Fahnen zu schreiben.
Wenn es aber weder historische noch soziale noch ideologische Fragen sind, die dem Wähler Orientierung geben, was dann? Was leitet uns, wenn der Fundamentalismus aus unserem Leben gewichen ist? Trommelwirbel, Raunen im Publikum, hier kommt meine Idee: Zur Wahl stehen Lebensstile.
Der Siegeszug der Grünen ist dafür der augenfälligste Beweis. Im Öko-Lifestyle vereinen sich kleinbürgerliche und bäuerliche Ambitionen einer postindustriellen Idylle, die „Genuss ohne Reue“ will und IKEA kriegt. Und mit IKEA beglückt ist. Gerade in diesem Moment ist „Knut“: Werfen Sie den Christbaum auf den Müll und hin zum Lifestyle-Haus! Der Zeitgeist ruft, und wir folgen. Wir werfen das Christensymbol auf den Müll und pilgern zu den Köttbullar.
Dieser Öko-Hedonismus für Beamte und andere Empfänger von Transferleistungen ist in unserer Alltagskultur zu einer hegemonialen Kraft geworden, zu einem Kraftzentrum der Lebensentwürfe. Die Leitkultur ist grün, und man nimmt nichts mehr zu sich, es sei denn, es stünde bio drauf. Diese Soziokultur ist quasi-religiös, sprich mit einer regelrechten Glaubensgewissheit beseelt. Anders ließe sich gar nicht erklären, zu welchen Albernheiten man sich mit dem Kitsch und Tand der IKEA-Reliquien hinreißen läßt.
Wie in allen Vulgär-Religionen fügt sich auch Widersprüchlichstes herrlich zusammen: Man kann gegen das Auto („Rasen“) sein und zugleich den Ausbau des Schienennetzes behindern. Man kann gegen Atome sein und alternative Energien wollen, aber kein nationales Netz. Man kann glauben, dass es freilaufende Eier gibt. Und zum Nicht-Idyllischen gilt Sankt Florian, neudeutsch Nimby: not in my backyard.
Die Anschlussfähigkeit dieser harmonie-seligen BIO-Logie zu anderen, ebenfalls neuen Lebenstilen ist hoch. Das konservative Milieu, soweit es an der Macht ist, wird in der Merkel-Republik von den Hosenanzügen beherrscht, die der Biologie nach Frauen sind, der Erscheinung nach aber androgyne Apparatschiks. In den Augen eines Mannes meiner Generation, wenn man das sagen darf, Wesen ohne jeden Charme, jedenfalls ohne das, was Franzosen feminin oder Engländer eine Dame nennen würden.
Und die Verödung der FDP, einst Hort eines vielfältigen Liberalismus, lässt sich genau so verstehen. Die Lebenswelten der Menschen wie Genscher, Hamm-Brücher, Lambsdorff, Baum waren uneinheitlich, aber doch liebenswert und achtbar, von hegemonialer Attraktivität, die etwas bessere Bürgerlichkeit, frei vom Mief des Reaktionären. Das hat sich mit dem Zeitalter des Antisemiten Möllemann und des Autisten Westerwelle geändert. Die FDP war das feinste Tuch der Parteienlandschaft und ist nun ein leerer Anzug, ein Herrenanzug in einer Welt der vorsätzlich Unberockten.
Weiterer Menschheitstraum, Unterabteilung Verwelktes: Rot-grün, ersonnen in weinseligen Runden in Bonner Kneipen von den radikalen Oppositionellen Schröder und Fischer. Die Neue Mitte mit eigener Mehrheit, sie ist ausgeträumt, jedenfalls für die Sozis. Schröder und sein Hausmeier Müntefering haben die Sozialdemokratie in Berlin nachhaltig zerlegt. Der Bonner Traum, ein rheinischer Kapitalismus mit linker Seele, ist an der Spree in der Märkischen Wüste versandet. Das Sterne-Restaurant, in dem Schröder mit Fischer Kellner und Koch spielte, hat die SPD an die Grünen abgegeben. Verglichen damit hat Sigmar Gabriel jetzt eine Suppenküche, in der sein ostfriesischer Genosse Garrelt Duin noch vor aller Augen ins Essen spuckt. Ein Bild der Würdelosigkeit ausgerechnet jener Partei, die um der Würde ihrer Anhänger gegründet wurde.
Dafür sind 24 Prozent der Wählerstimmen schon fast beachtlich. Die SPD, in der Großen Koalition um die Identität gebracht und nunmehr degeneriert zum Juniorpartner der Grünen, wäre erst wieder mehrheitsfähig, wenn sie einen sehnlichst erwarteten neuen Lebensstil repräsentieren würde. Genau das war historisch der Erfolg von Willy Brandt und der von Tony Blair. Und die USA haben gegen den Lifestyle des stockdummen Bush-Filius den messianischen Traum des smarten Obama gestellt. Nicht Programme, nicht sogenannte Sachpolitik, keine Werte oder Interessen steuern das Wahlvolk, sondern ein starkes oder eben schwaches Angebot wünschenswerter Wirklichkeiten.
Verglichen damit findet selbst das Ancien Regime der Hosenanzüge wieder etwas Charme. Dass sie tüchtig sind, hat der Wähler längst gelernt; jedenfalls nicht weniger als die Herren der Schöpfung. Ja, der Lifestyle ist noch ein wenig bieder. Wenn die Hosenanzüge aber künftig von IKEA kämen, dann gäbe es keinen Grund zum Politikwechsel mehr. Merkel als Künast, Schavan als Roth. Man muss sich die Idee halt nur schöntrinken. Prost Neujahr.
Quelle: starke-meinungen.de
Logbuch
Neujahrswunsch: endlich einen Minister für gesunden Menschenverstand
Dies ist eine Jahrhundertidee, aber leider nicht von mir. Über die Feiertage habe ich einen wahren Berg an ungelesener Post und alten Zeitungen abgearbeitet. Darunter eine saustarke Meinung von Jeremy Clarkson. Die könnte man ohne weiteres klauen. Wer liest hierzulande schon englische Zeitungen?
Clarkson fordert einen „minister for common sense“, der als Sachwalter einer Alltagsklugheit jedweden Blödsinn untersagt. Das finde ich fabelhaft, ohnehin ist dieser englische Journalist mein großes Vorbild. Ich bewundere ihn, obwohl er mich mehrfach „the dodgy hun“ genannt hat, was soviel heißt wie der verrückte Deutsche („hun“ von Hunne) oder „nazi prat“. Ihm behagen meine preußischen Manieren nicht. Da kommen dann die historischen Vergleiche unsäglicher Art. Engländer dürfen das, weil sie den Krieg gewonnen haben. Weltberühmt haben Clarkson seine Eskapaden als Motorjournalist gemacht. Die BBC-Sendung „Top Gear“ gehört zum Abgedrehtesten, was der Journalismus zu bieten hat. Aber richtig gut ist er in seinen Meinungs-Kolumnen in der „Sunday Times“, in denen er sich als bürgerlicher Anarchist um politisch Unkorrektes bemüht. Im Gegensatz zu Henryk M. Broder oder anderen Rollenkaspern ist Clarkson völlig unberechenbar. Er schreibt die Wahrheit auch dann, wenn sie nicht absurd ist; das ist sehr selten bei Satirikern.
Und so fällt ihm zu WikiLeaks nur der Verweis auf den gesunden Menschenverstand ein, nach dem beim Zusammenbruch aller Geheimnisse und jedweder Privatheit ein gesellschaftliches Leben nicht mehr möglich ist. Ein starkes Argument: Wenn WikiLeaks Schule macht, ist keine Politik mehr möglich, auch keine Friedenspolitik. Blamiert und ausspioniert werden die Mächte wieder die Waffen sprechen lassen. Das kann niemand, der bei Verstand ist, wollen. Ein Minister für gesunden Menschenverstand würde einschreiten.
Bevor wir uns für Angela Merkel den Kopf zerbrechen, wer als Minister für den Common Sense in das Bundeskabinett einziehen sollte, muss man sich erst mal mit sehr deutschen Problemen beschäftigen. Das fängt schon bei der Sprache an. „Common Sense“, das klingt gut, wie „Commonwealth“, aber im Deutschen ist der Menschenverstand nicht nur ein „allgemeiner“, sondern sofort „gesund“, was den Schluss nahelegt, dass es auch „kranken“ Menschenverstand gebe.
Und Krankheiten gilt es auszumerzen. Da aktiviert sich ein gesundes Volksempfinden. In einem Land, in dem es mal ein „Ministerium für Volksaufklärung und Propaganda“ gab, ist Sorglosigkeit bei solchen Begriffen fehl am Platze. Das Problem mit Ressentiments in der Politik ist ja, dass sie nach geeigneter Propaganda beinahe jedermann teilt.
Die Lösung liegt in einem anderen Amt: Der Bundespräsident sollte das doch können. Christian Wulff als Prinzip der Vernunft? Wenn es dazu nur einen Funken der Hoffnung gäbe. Seine Weihnachtsansprache war von der philosophischen Brillianz eines Glückskekses: Wir sollen Respekt haben und hilfsbereit sein, sagt er, und zwar im Stehen.
Und das preist die Republik als eigentliche Innovation: Wulff hat es im Stehen gemacht. Hurra. Natürlich geht es auch anders. Man muss Elisabeth II, die englischen Kollegin von Wulff, in ihrer Weihnachtsansprache zur „King-James-Bible“ (das ist die Luthersche Großtat für England) gehört haben: zwischen Bildung und Klasse auf der einen Seite und Gefälligkeit und Gemeinplatz auf der anderen liegt mehr als nur der Ärmelkanal.
Grinsende Gemeinplätze sind aber etwas anderes als die solide Skepsis des Bodenständigen. Der Lübke-Epigone Wulff als Höhe der praktischen Vernunft: echt jetzt? Nein, machen wir uns das klar, der Ort des gesunden Menschenverstandes ist nicht die Politik.
Stimme verleihen kann dem gesunden Menschenverstand nur eine freie und selbstbewusste Presse. Wenn sie es denn täte. Meine Zweifel wachsen mit jedem Blatt, das ich in die Hand nehme. Mit diesem Neujahrswunsch wird es werden, wie mit meinen anderen beiden; dass ich nie mehr über’s Maß trinke und zehn Kilo abnehme. Sie werden den Dreikönigstag nicht überleben.
Ich weiß gar nicht, warum ich immer wieder auf die starken Meinungen von Clarkson anspringe. Sicher war sein Vorschlag nur die bittere Ironie eines Gentleman, jener schwarze Humor, auf den Preußen wie die Trottel reinfallen?
Die Ideen der Engländer sind einfach nicht mehr, was sie mal waren. Erinnert mich an Monty Python: die legendäre Satirikertruppe hatte das „Ministerium für alberne Gangarten“ erfunden. The Minister of funny walks parodierte den preußischen Stechschritt. Wehe dem, der die Ironie-Signale nicht sieht. Reden wir, so hieß das in Preußen, über’s Räsonnieren: Der Menschenverstand ist vielleicht am Ende nur gesund, wenn er der Macht misstraut. Deshalb bekleidet er keine Ministerämter, er tobt am Stammtisch, in der Kaffee-Ecke vom Büro, auf den Marktplätzen, in den Blogs, und gelegentlich erreicht er auch mal einen Leitartikel der Tagespresse. Selten genug.
Quelle: starke-meinungen.de
Logbuch
Das Weihnachts-Interview: Kant zum Kult von Kundus
Weihnachten im Felde: das ist ein sehr deutsches Thema. Das Feldlager in Kundus wird just zur adventlichen Kulisse politischer Kundgebungen. Kaum ist der Bundesverteidigungsminister nebst Gattin und Talkmaster Kerner aus dem Kriegsgebiet zurückgekehrt, darf die Truppe eine neue Bühne für einen weiteren Besuch zimmern: Die Kanzlerin reist mit zu Guttenberg an.
Fotos flattern uns auf den Adventstisch, die Merkel mit zu Guttenberg und Offizieren betend in der Ehrenhalle der Bundeswehr zu Kundus zeigen, vor einem geschmückten Weihnachtsbaum, im Gedenken an die Gefallenen. Ehre, wem Ehre gebührt. Aber man darf in diesem Zusammenhang nicht nur von Kriegspropaganda sprechen, man muss es, wenn Sachfragen der Außen- und Verteidigungspolitik derart zu Personality-Formaten des Boulevard gewandelt werden. Wir sprachen mit Moral in der Politik und Showbusiness statt Politik mit dem Königsberger Philosophen Professor Immanuel Kant.
Kocks: „Professor Kant, die Befürworter der Talkshow in Kundus führen an, dass man auch zu modernen Mitteln der Kommunikation greifen müsse, um den Menschen im Lande Sinn und Zweck der Politik zu erklären. Für einen modernen Patriotismus sei jedes Mittel recht. Was sagt das über den Zustand der politischen Kultur?“
Kant: „Eine Politik, welche, was den Punkt der Mittel betrifft, nicht bedenklich ist (also die des Polikasters), ist Demagogie. Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Theil der Menschen gerne zeitlebens unmündig bleibt, und warum es Anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Daß der größte Theil der Menschen den Schritt zur Mündigkeit, außer dem dass er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte: dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gütigst auf sich genommen haben.“
Kocks: „Aber muss nicht gerade eine wertgebundene Politik Sorge tragen, von breiten Kreisen der Bevölkerung verstanden zu werden? Da kann doch Personalisierung, die Einbeziehung der eigenen Familie, wie wir es bei Wulff und zu Guttenberg erleben, nur helfen. Braucht nicht gerade die moralische Politik eine gewisse Raffinesse der Darstellung?“
Kocks: „Es geht nicht um Rechtsbrüche. Der Auslandseinsatz der Bundeswehr ist ja parlamentarisch gedeckt. Meine Frage bezog sich auf das Verhältnis von Moral und Politik. Sind diese Truppenbesuche nicht auch ein moralisches Vorbild für eine Gesellschaft, die immer gleichgültiger gegenüber Grundwerten wird? Brauchen wir nicht mehr politische Moralisten?“
Kant: „Ich kann mir nun zwar einen moralischen Politiker, das ist, einen, der die Prinzipien der Staatsklugheit so nimmt, dass sie mit der Moral zusammen bestehen können, aber nicht einen politischen Moralisten denken, der sich eine Moral so schmiedet, wie es der Vorteil des Staatsmannes sich zuträglich findet.“
Kocks: „Sie sind sehr rigoros, was den Anspruch angeht, nachdem die Maximen unseres Handelns zugleich immer auch als Grundsätze einer allgemeinen Gesetzgebung annehmbar sein sollten. Ist das aber nicht doch reine Theorie, fern der politischen Praxis?“
Kant: „Es kann keinen Streit der Politik als ausübender Rechtslehre mit der Moral, als einer solchen, aber theoretischen geben (mithin keinen Streit der Praxis mit der Theorie): man müsste denn unter der letzteren eine allgemeine Klugheitslehre, das ist eine Theorie der Maximen, verstehen, zu seinen auf Vorteil berechneten Absichten die tauglichsten Mittel zu wählen, das ist, leugnen, dass es überhaupt eine Moral gebe.“
Kocks: „Aufgabe der Politik ist es doch, so lautet, glaube ich, der Amtseid, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und die tatsächliche Bedrohung etwa durch Terrorakte wird in diesen Tagen ja geschürt. Auf jedem Bahnhof stehen schießbereite Polizisten. Hilft in dieser Welt Prinzipienreiterei?“
Kant: „Die politischen Maximen müssen nicht von der aus ihrer Befolgung zu erwartenden Wohlfahrt und Glückseligkeit eines jeden Staats, also nicht vom Zweck, den sich ein jeder derselben zum Gegenstande macht (vom Wollen), sondern von dem reinen Begriff der Rechtspflicht (vom Sollen, dessen Prinzip a priori durch reine Vernunft gegeben ist) ausgehen, die physischen Folgen daraus mögen auch sein, welche sie wollen.“
Kant: „Wir müssen annehmen, die reinen Rechtsprinzipien haben objektive Realität, das ist, sie lassen sich ausführen; und danach müsse auch von Seiten des Volks im Staate und weiterhin von Seiten der Staaten gegeneinander gehandelt werden; die empirische Politik mag auch dagegen einwenden, was sie wolle. Die wahre Politik kann also keinen Schritt tun, ohne vorher der Moral gehuldigt zu haben.“
Kocks: „Und doch lodert allenthalben Doppelmoral und Unfrieden. Und in Afghanistan, haben wir gelernt, findet der Krieg gegen den Terror statt, wie im Irak. Wie blauäugig muss man sein, um in einer solchen Welt vom ewigen Frieden zu reden?“
Kant: „Es soll kein Krieg sein. Also ist nicht die Frage, ob der ewige Friede ein Ding oder Unding sei, sondern wir müssen so handeln, als ob das Ding sei, was vielleicht nicht ist, und auf Begründung desselben und diejenige Konstitution, die uns dazu die tauglichste scheint, hinwirken, um ihn herbeizuführen und dem heillosen Kriegsführen ein Ende zu machen.“
Kant: „Nationalstolz und Nationalhass sind Instinkte, die die Tierheit an uns dirigieren, aber durch Maximen der Vernunft ersetzt werden müssen. Um dessenwillen ist der Nationalwahn, jener Wahn, den Regierungen so gerne sehen, auszurotten, an dessen Stelle Patriotismus und Kosmopolitismus treten muß.“
Kocks: „Und das kann man in einer Verfassung haben, Vaterlandsliebe und Weltbürgertum? Sie träumen vom ewigen Frieden!“
Kant: „Wir reden von einer auf Freiheitsprinzipien gegründeten Verfassung aus der Idee der Vernunft. Drei Definitivartikel zum ewigen Frieden, einer unausführbaren Idee, wenngleich letztes Ziel des ganzen Völkerrechts: 1. Die bürgerliche Verfassung in jedem Staate soll republikanisch sein. 2. Das Völkerrecht soll auf einem Föderalismus freier Staaten beruhen. 3. Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein.“
Kocks: „ Hospitalität? Das Lateinische hat ja mit dem Begriff „hospes“ ein und dasselbe Wort für den Fremden wie für den Gast. Meinen Sie das: Der Fremde als Gast, Gastfreundschaft als Prinzip, auch im weltbürgerlichen Maßstab?“
Kant: „Er versteht schon recht. Frohe Weihnacht, Friede auf Erden und den Menschen einen Wohlgefallen.“
Kocks: “Professor Kant, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.“
Quelle: starke-meinungen.de