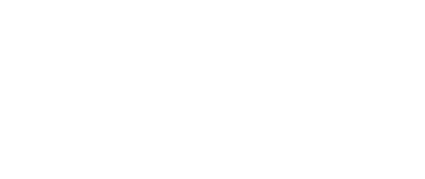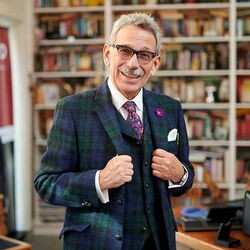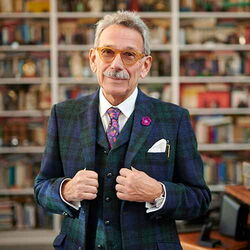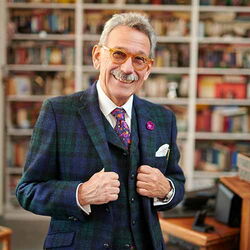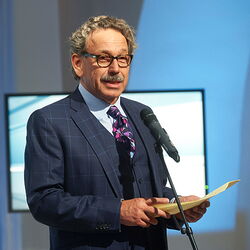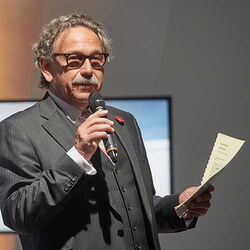Logbuch
ZEITZEUGE.
Wäre ich Literaturkritiker, würde ich nach Wegen suchen, mein höchstes Lob zu formulieren. Ich habe gerade ein wirkliches Meisterwerk gelesen. Daniel Kehlmann, Lichtspiel, Rowohlt. Fast fünfhundert Seiten. Erzählt wird eine Lebensgeschichte rund um den Regisseur G. W. Pabst, der aus der Weimarer Republik in die USA emigriert, aber schnell in das Reich von Joseph Goebbels zurückkehrt und unter dessen Duldung dreht, bis zu seinem Ende im Nachkriegseuropa. Hinter diesen Ereignissen wird sehr deutlich, wie ein Volk im Faschismus versinkt. Aber ich will nicht zu viel verraten. Lesebefehl!
1930 hat G. W. Pabst den Dreigroschenfilm nach Brechts Dreigroschenoper gedreht; was der große BB zu allerlei Prozesshanselei nutzte. Ich habe darüber promoviert. Und hielt dabei irgendwann das Originaldrehbuch in Händen mit den Notizen des großen G. W. Pabst. Zahlreiche Anmerkungen. Enno Patalas aus dem Münchner Stadtmuseum hatte mir das Konvolut überlassen, das ich einer Erstbearbeitung unterzog.
Das kommt mich jetzt mit eigener Betroffenheit an. Wann war man schon mal so nah an großer Geschichte dran. Ich werde Brechts Schrift zum Dreigroschenprozess jetzt noch mal sorgfältig lesen. Falls ich Kehlmann im Borchardt treffe, will ich vorbereitet sein.
Logbuch
WER SITZT AM STEUER?
Man könnte es in 50 Stunden hinkriegen, wenn man durchführe. Bei kommoderen Tagestouren geht es in einer guten Woche. Wir sprechen von dem 4500 km zwischen Atlantik und Pazifik, einmal mitten durch Amerika. Das ist die Tour „coast to coast“, die man mit Benzinkutschen ablegen kann, wenn man sieben, acht Mal an die Pumpe möchte. Mit meinem Diesel reichten 5 Tankaufenthalte. Das wäre aber unmodern.
Meinem italienischen Freund in Wolfsburg scheint das keine unüberbrückbare Distanz; er lächelt mich an. „Das ist eine Mal Palermo und zurück!“ Nun gut, die Gewalttouren der Gastarbeiter in ihre ursprüngliche Heimat sind ein anderes Thema. Zudem habe ich einen Verdacht bei den Einkaufstouren der Pizzeria in Niedersachsen nach Sizilien wegen der besonders leckeren Tomaten, dem ich hier nicht nachgehen möchte. Wir reden also nicht von bolivianischem Marschierpulver, wenn wir über Elon Musk und sein Batterie-Auto namens Tesla reden; diesmal nicht.
Das batteriebetriebene Gefährt wird beworben, indem seiner Steuerungstechnik bescheinigt wird, dass die Karre „autonom“ fahren könne, sprich ohne Eingreifen des Fahrers selbständig zu ihrem Ziel finde. Gemeint ist „automatisch“, was nicht das Gleiche ist; aber geschenkt. Ein jüngstes Experiment mit dem „self driving coast to coast“ endete nach 90 von den 4500 km im Crash. Keine Schadenfreude meinerseits. Mir war seit dem ersten Versprechen des Tesla-Eigners 2018 klar, dass wir über einen Marketing-Mythos reden.
Ich habe von dem rennbegeisterten Ferdinand Piëch gelernt, dass ein skrupelloser Fahrer mehr zum Sieg beitrage als ein perfektes Fahrzeug. Aber es geht mir nicht um die Mentalität der Racer, obwohl dazu einiges zu sagen wäre. Wie zu den Tomatenlieferungen. Es geht mir um ein Grundgesetz der Kybernetik. Das ist die Wissenschaft von den Steuerungsmaschinen, den Daten-Automaten. Ich hab das studiert.
Die Selbstregulierung stößt an eine natürliche Grenze, wenn der zu steuernde Vorgang zu komplex wird. Irgendwann ist die Steuerung nicht mehr durch eine Erhöhung der Regler zu verbessern, sondern nur noch durch die Entkomplizierung der Regelstrecke. Die Erhöhung der Regelleistung ist nur bis zu einem gewissen Punkt dem Regelerfolg förderlich; dieser mag sich mit jeder Generation von Rechnern erhöhen, aber er ist endlich; der Prozess kippt irgendwann um und endet automatisch und zunehmend im Chaos.
Praktischer? Mehr Computer ist nicht die Lösung, sondern das Problem. Noch praktischer? Wenn der Rechner so groß ist, dass die Karre autonom von Küste zu Küste fahren kann, ist kein Platz mehr für Passagiere. Außer der Rechner wäre gar nicht in meinem Auto, sondern in Elons Zentrale. Und diese Art von Autonomie möchte ich nicht.
Logbuch
WATT IS NE DAMPF MASCHIEN?
Ein dunkler Raum mit zwei Löcher. Kennen wir aus der Feuerzangenbowle. Was ist eine Daten-Maschine? Da wird das Eis dünner. Das weiß nicht jeder. Es ist so wie früher bei den Zeitungen auf Papier; auch wer nicht wusste, wie man darin schreibt, konnte anderntags noch den Fisch darin einwickeln. Heute erfahren wir Neuigkeiten aus dem Smart-Phone, einem kleinen Scheißding, das unser Weltzugang geworden ist. Leider hat das Biest aber Algorithmen. Und KI, künstlichere Intelligenz. Das gefällt nicht jedem.
Ja, der Algorithmus, bei dem ein jeder mitmuss. Und die KI, mysteriös wie nie. Ich sitze in einem kreuznetten Kreis von Nachbarn und diskutiere mit einem hochgestellten Politiker über die Sozialen. Meine banale These: Was mal die Hinterzimmer von Kneipen waren, nämlich die kleinste und naheste Form von Öffentlichkeit, das findet sich für die junge Generation in den Social Media des Internets. Aber es kommt eben nicht jeder rein. Früher in die Kneipe, jetzt in das Netz.
Darauf reagieren die ANALOGEN wie immer mit Empörung. Natürlich sei man auf den Sozialen. Aber wie! Es erinnert mich an die Frage meiner frühsten Jugend danach, ob jemand schon Telefon habe; gemeint war ein Festnetzanschluss der Post. Oder ob man zu Hause schon Farbfernsehen besitze. Diese beiden übrigens die letzten Technologien, deren Einführung die SPD uneingeschränkt begrüßt hat. Heutzutage haben alle Internetz, die Bürgersteige werden gerade aufgegraben für Glasphaser, die nächste Phase.
Zeitgleich berichtet über lokale Ereignisse noch ein Druckerzeugnis, das sich allerdings keine Redaktion mehr leisten kann und deshalb die Erlebniserzählungen der lokalen Matadore eins zu eins ins #Blatt hebt. Blättchen, so nennt man das am Ort; zu recht in Verkleinerungsform. Wir sind Zeitzeugen einer epochalen Ungleichzeitigkeit gänzlich unterschiedlicher Techniken. Ich sage es mal so: Im Kulturellen ist das Verbrennerverbot noch nicht angekommen.
Der politische Grande führt aus, dass das Internetz nicht demokratie-geeignet sei, weil die Sozialen amerikanischen Milliardären gehörten, die darin Algorithmen & KI installiert hätten, mittels derer verdeckt Wahlen manipuliert würden. Es gebe sogar Hass & Propaganda. Er setzt große Hoffnungen auf den Digital Services Act der EU. Es erklingt der Ruf nach dem starken Staat, der Urimpuls aller Sozis, wenn etwas nach der Willkür des Marktes riecht. Algorithmen also. Teufelszeug. Man weiß im Alltagswissen älterer Menschen auch nicht annähernd, was die DIGITALEN umtreibt. Unsere Gesellschaft ist kulturell gespalten. Die Zahl der neuen Analphabeten ist groß.
Die KYBERNETISCHE WENDE findet statt, ist aber intellektuell nicht verdaut. Wir nutzen inzwischen alles, was wir noch begreifen; aber eben auch nicht mehr müssen, weil der Mangel an natürlicher Intelligenz ja ausgeglichen wird durch die künstliche. Aber ganze Milieus sind mittlerweile Altersheime des Analogen. Die Klugen unter den politischen Köpfen wissen das und begehren auf. Ich rechne über kurz oder lang mit der Forderung nach einem Algorithmus-Verbot.